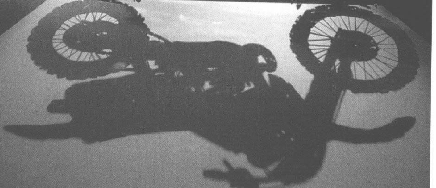Diesen einleitenden Eingangssätzen ist eine – wie man vielleicht meinen mag – sonderbar
anmutende Überschrift vorgestellt, auf die im Folgenden zunächst eingegangen werden
soll, um von dort den Bogen zu den Neuen Medien, dem Internet und zur Musik zu
schlagen. Der Umweg über jene befremdlich wirkende Zeichenwelt wird deshalb gewählt,
weil aus ihr eine die Gesamtarbeit tragende Programmatik abzuleiten ist. Implizit sind
mit dem rätselhaft Anmutenden das Prinzip der Kontingenz und das der Differenz
angesprochen, die die Arbeit inhärent begleiten werden. Ähnliches gilt für das oben
dargestellte Bild, das gleichsam eine kurze Kommentierung im weiteren Verlauf
verdient.
Wiederholt sei zunächst die Eingangsfrage: Kennen Sie [ ]? Unschwer ist zu
erkennen, dass anstelle des uns wohlvertraut Buchstäblichen die phonetische
Lautschrift gewählt wurde. Wäre die Schrift wie gewohnt genutzt, würde allerdings
allein das Evidenzprinzip Geltung beanspruchen, denn auf der Ebene des reinen
Blickkontaktes mit dem geschriebenen Wort würden Vorstellungen über die rechte
Aussprache dermaßen signifikant geleitet, dass jede andere Möglichkeit zur
Lautwerdung Lesenden nicht nur nicht in den Sinn geraten würde, sondern sie
würden voreilig als prinzipiell »falsch« erachtet werden. Der Kontingenz und
so dem Unterschied ist nur im Lautlichen, aber nicht im Geschriebenen zu
begegnen. Mit der Einschreibung in feste Körper waltet eine Eindeutigkeit –
allerdings scheinbare nur –, die sich auflöst, sobald die Signifikantenkette allein
zu hören ist. Beim Lesen hören wir zugleich Gelesenes und grenzen praktisch
imperativ anderes aus. Für unser Beispiel heißt das: Gewohnt zu sagen [
]? Unschwer ist zu
erkennen, dass anstelle des uns wohlvertraut Buchstäblichen die phonetische
Lautschrift gewählt wurde. Wäre die Schrift wie gewohnt genutzt, würde allerdings
allein das Evidenzprinzip Geltung beanspruchen, denn auf der Ebene des reinen
Blickkontaktes mit dem geschriebenen Wort würden Vorstellungen über die rechte
Aussprache dermaßen signifikant geleitet, dass jede andere Möglichkeit zur
Lautwerdung Lesenden nicht nur nicht in den Sinn geraten würde, sondern sie
würden voreilig als prinzipiell »falsch« erachtet werden. Der Kontingenz und
so dem Unterschied ist nur im Lautlichen, aber nicht im Geschriebenen zu
begegnen. Mit der Einschreibung in feste Körper waltet eine Eindeutigkeit –
allerdings scheinbare nur –, die sich auflöst, sobald die Signifikantenkette allein
zu hören ist. Beim Lesen hören wir zugleich Gelesenes und grenzen praktisch
imperativ anderes aus. Für unser Beispiel heißt das: Gewohnt zu sagen [ ]
kann [
]
kann [ ; auch
; auch  wäre möglich] nur konsequent als falsch bedeutet
werden.
wäre möglich] nur konsequent als falsch bedeutet
werden.
Aber recht besehen wohnt auch [ ] eine gewisse Logik inne, sofern man die
Qualifizierung falsch vorerst einmal zurückstellt und nachfragt, wie es zu dieser fremden
und unvertraut klingenden Klangwelt hat kommen können. Also noch einmal bzw. schon
wieder: Kennen Sie [
] eine gewisse Logik inne, sofern man die
Qualifizierung falsch vorerst einmal zurückstellt und nachfragt, wie es zu dieser fremden
und unvertraut klingenden Klangwelt hat kommen können. Also noch einmal bzw. schon
wieder: Kennen Sie [ ]? Wahrscheinlich nicht, und auch der Schreiber dieser Zeilen
vernahm jene Lautdifferenz mit Erstaunen, als sie ihm im Musikunterricht einer Klasse 8
begegnete. Jene an den Anfang gestellte Kernfrage ist also keine bloße Kopfgeburt,
sondern entsprungen dem tatsächlichen Musikunterricht, als ein Schulbuchtext zum
Thema musikalische Klassik von einem Schüler verlesen wurde. Thematisiert
wurde darin unter anderem eben auch [
]? Wahrscheinlich nicht, und auch der Schreiber dieser Zeilen
vernahm jene Lautdifferenz mit Erstaunen, als sie ihm im Musikunterricht einer Klasse 8
begegnete. Jene an den Anfang gestellte Kernfrage ist also keine bloße Kopfgeburt,
sondern entsprungen dem tatsächlichen Musikunterricht, als ein Schulbuchtext zum
Thema musikalische Klassik von einem Schüler verlesen wurde. Thematisiert
wurde darin unter anderem eben auch [ ] . Nur waren
] . Nur waren